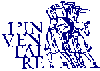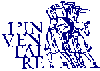Mauermarkierung
Eigene Texte > 1995
 Dolff-Bonekämper, Gabi: Denkmalschutz - Denkmalsetzung - Grenzmarkierung: Erinnerungsarbeit an der Berliner Mauer. – In: Markierung des Mauerverlaufs [in Berlin]: Hearing am 14. Juni 1995. Dokumentation / hrsg. von Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, Abt. Städtebau und Architektur - Kunst im Stadtraum. – Berlin, 14.06.1995. – p. 39–40. Dolff-Bonekämper, Gabi: Denkmalschutz - Denkmalsetzung - Grenzmarkierung: Erinnerungsarbeit an der Berliner Mauer. – In: Markierung des Mauerverlaufs [in Berlin]: Hearing am 14. Juni 1995. Dokumentation / hrsg. von Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, Abt. Städtebau und Architektur - Kunst im Stadtraum. – Berlin, 14.06.1995. – p. 39–40. | ||
Unmittelbar nach der Öffnung der Mauer begannen die Diskussionen über den zukünftigen Umgang mit dem Bauwerk. Sollte die Mauer als gewaltiges Verkehrshindernis so rasch wie möglich abgeräumt werden, und zwar komplett? Oder sollte man sich bemühen, sie zu erhalten, weil sie als Zeugnis der deutschen Teilung – und ihrer Überwindung – in Zukunft niemals aus den Augen verloren werden durfte?
Wir Denkmalpfleger aus dem Westen und manche aus dem Osten der Stadt neigten damals der zweiten Auffassung zu. Die Mauer war zweifelsohne ein Geschichtsdenkmal von größter nationaler, ja internationaler Bedeutung. Wir dachten, die Öffnung der unterbrochenen Straßen könnte zur Wiederanknüpfung der urbanen Bezüge genügen, die Mauer und die Grenzanlagen könnte man dem allmählichen Verfall überlassen; sichern, instandsetzen oder gar restaurieren würde man sie nicht.
Diese Position erwies sich als unhaltbar, vereinter Politiker- und Bürgerwille stand dagegen. Die Erhaltung der ganzen Mauer als denkmalpflegerisches Ziel erschien bald unverhältnismäßig, geradezu anmaßend. Ein Ost-Berliner Denkmalpfleger schlug vor, Teile der Mauer als Mahnmale dort zu erhalten, wo sie am meisten geschmerzt hatte – und nicht etwa da, wo sie am wenigsten störte. An signifikanten Orten in der Stadt die Erinnerung an die Teilung wach zu halten und für spätere Generationen originale Reste der DDR-Grenzbefestigung in situ zu bewahren – das war eine realistische denkmalpflegerische Zielsetzung.
So wurden noch zur Zeit der Ost-Berliner Magistratsregierung im Jahre 1990 drei kürzere Abschnitte der Mauer unter Denkmalschutz gestellt: einer an der Niederkirchnerstraße vor dem ehemaligen Gestapo-Gelände, einer auf dem friderizianischen Invalidenfriedhof und einer an der Bernauer Straße. Später kamen die „East-Side-Gallery“ an der Stralauer Straße und ein Wachturm am Schlesischen Busch in Treptow hinzu. An der Bernauer Straße fand im Sommer 1990 ein Wettlauf zwischen der Denkmalpflege und den Grenztruppen der Nationalen Volksarmee statt. Abrüstungsminister Rainer Eppelmann setzte die Soldaten zum Abbau der Grenzanlagen ein, die zuvor ihre Zeit damit verbracht hatten, sie zu bewachen. – Was Wunder, daß die Abbrecher mit einem ungeheuren Furor zu Werk gingen und sich nicht darum kümmerten, daß die Denkmalpflege Schutzverfügungen ankündigte. Am Ende gelang es nur, den 210 Meter langen Abschnitt zwischen Acker- und Bergstraße auf dem ehemaligen Gelände des Sophienfriedhofs zu bewahren. Im Chaos der Abbrucharbeiten im Sommer 1990 sorgte das Deutsche Historische Museum für die Sicherung des Geländes zwischen Grenzmauer und Hinterlandmauer und bemühte sich seitdem um Konzept und Realisierung einer Gedenkstätte.
Unterdessen feierten die Berliner die Öffnung der Grenzen. Die Wiederherstellung von Straßenverbindungen und die Wiederinbetriebnahme von Brücken wurden festlich begangen. Die Grenzen überschreiten zu können ohne Kontrolle, ohne Zwangsumtausch, einfach so zu Fuß oder mit PKW, U- oder S-Bahn, löste ein unvergleichliches Hochgefühl aus. Der nach dem Abbruch der Grenzanlagen freigewordene Geländestreifen wurde für Erkundungen zu Fuß oder Fahrrad genutzt. Überall weitere sich das Blickfeld. – Nicht so in der Bernauer Straße zwischen Acker- und Bergstraße, gegenüber dem Lazarus-Krankenheim, wo in den Jahren nach dem Mauerbau die verletzten Flüchtlinge versorgt worden waren. Hier standen sich nun nicht mehr die Weltmächte gegenüber, sondern Bürger, Politiker und Kirchenleute aus Wedding und Mitte. Die Weltgrenze war wieder zur Bezirksgrenze abgesunken. Im Frühjahr 1991 brach dort ein äußerst heftiger Streit darüber aus, ob die Erhaltung des denkmalgeschützten Grenzstreifens für die am Ort Lebenden überhaupt zu ertragen wäre. War der Anblick des Mauerrestes zu deprimierend, weil er an erlittenes Unrecht erinnerte? Oder war er im Gegenteil sogar erfreulich, weil das Bauwerk, von „Mauerspechten“ aufgepickt und bunt besprüht, ein Denkmal seiner Überwindung geworden war? Wieviel Mauer war zuviel, wieviel genug? Die Gedenkstätte gegen den Willen eines Teiles der Anwohner zu errichten, war so unmöglich wie der Verzicht auf die Gedenkstätte.
[p. 40:]
Senat, Deutsches Historisches Museum und Kirchengemeinde fanden einen Kompromiß: Im April 1994 wurde ein künstlerischer Wettbewerb zur Gestaltung der Gedenkstätte ausgelobt. Die Jury vergab drei zweite Preise, die die Unterschiedlichkeit und Unvereinbarkeit der denkbaren Lösungsmöglichkeiten widerspiegeln:
Susanne Winkler und Stefan Thiel (Berlin) wollten den Grenzraum mitsamt der Mauer auf ca. 110 Metern Länge mit einem 15 Meter hohen doppelwandigen Streckmetallzaun umgeben. Der ehemalige Todesstreifen sollte unbetretbar und der Blick auf das Gebäude nur durch einen horizontalen Schlitz in der inneren Zaunwand möglich sein. – Ein starkes Zeichen, das allerdings mit seiner schieren Größe die noch vorhandenen materiellen Reste der Grenzanlagen übertönen würde.
Der Entwurf des Büros Kohlhoff & Kohlhoff (Stuttgart), der inzwischen zur Verwirklichung ausgewählt wurde, faßt 60 Meter Grenzstreifen mit zwei 6 Meter hohen polierten Stahlwänden ein, die den Grenzraum ins Unendliche spiegeln sollen. Was den Platzbedarf angeht, unterschreitet der Entwurf noch den Minimalkonsens, der der Ausschreibung zugrundelag. Ob, was und wie lange die Stahlwände wirklich spiegeln werden, bleibt abzuwarten.
Die von der Denkmalpflege favorisierte Lösung von Markus Antonius Bühren und Markus Maria Schulz (Allensbach) sah vor, den gesamten erhaltenen Grenzstreifen so zu belassen, wie er sich in der Gegenwart des Wettbewerbs darstellte. Nur die alte Friedhofsmauer, die zur Errichtung der Grenzanlagen abgebrochen worden war, sollte wieder entstehen, um den Grenzstreifen dem Friedhof räumlich wieder anzugliedern. Die Umsetzung dieses Entwurfs scheitert daran, daß die Autoren sich über die Ausschreibungskompromisse hinwegsetzten.
Aber selbst wenn Kirche, Museum, Politik und Verwaltung sich vom Motto der Allensbacher hätten überzeugen lassen – „Kein Denkmal“ – wäre damit noch nicht alles entschieden gewesen. Wie sollte man mit dem Boden des Grenzstreifens umgehen? Ständig alle Pflanzen herausreißen, vielleicht gar mit Pflanzenvernichtungsmitteln den Neuwuchs verhindern, um so den – 1994 schon längst nicht mehr vorhandenen – ursprünglichen Zustand zu bewahren? Oder nur regelmäßig mit dem großen Rasenmäher den Bewuchs kürzen, was mit der Zeit eine dichte Wiese ergeben würde? Oder alles wachsen lassen, wie es ein anderer Entwurf im Wettbewerb vorschlug, was noch einigen Jahren eine ähnliche Vegetation ergäbe, wie sie vom Schöneberger Südgelände bekannt ist? Wollte man, daß sich nichts ändert, müßte man ständig eingreifen; wollte man nicht eingreifen, würde sich alles verändern. Welches Verfahren würde aber der Erinnerungsarbeit förderlicher sein und die Bedeutung des Ortes besser vermitteln?
Das denkmalpflegerische Ziel ist klar: möglichst viel von der originalen Substanz der Grenzanlagen an ihrem angestammten Ort zu bewahren, damit die Bewohner und Besucher mit eigenen Augen sehen können, wie die innerstädtische Grenze aufgebaut war. Unklar wird die Sache, sobald Fragen der Gestaltung – oder der Nicht-Gestaltung – aufgeworfen werden. Moralisierende, dramatisierende und distanzierende Ansätze stehen gegeneinander, und das nicht nur in bezug auf die Gedenkstätte an der Bernauer Straße. Der einzige Konsens zum Thema „Mauer“, der zur Zeit greifbar zu sein scheint, ist, daß die Grenze existiert hat und, wenngleich sogar auch darüber gestritten werden kann, wo sie verlief.
In dieser historischen Situation kommen Projekte zur Markierung des Mauerverlaufes durchaus zupaß: Die Markierung, ganz gleich, ob sie als Kunst empfunden wird oder nur als „kunstloses“ Zeichen, unterschreitet die Schwelle der moralisierenden wie der dramatisierenden Aufbereitung. Sie hält die Option offen, jetzt oder später über die Geschichte und Bedeutung der „Berliner Mauer“ nachzudenken, und zwar am Ort des Geschehens, im Stadtraum und nicht nur anhand bildlicher oder schriftlicher Abstraktionen in Museum oder Bibliothek. Alle weiteren Arbeiten – künstlerische, historische oder planerische – können und sollten darauf aufbauen.
Zitiervorschlag:
Dolff-Bonekämper, Gabi: Denkmalschutz - Denkmalsetzung - Grenzmarkierung: Erinnerungsarbeit an der Berliner Mauer. – In: Markierung des Mauerverlaufs [in Berlin]: Hearing am 14. Juni 1995. Dokumentation / hrsg. von Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, Abt. Städtebau und Architektur - Kunst im Stadtraum. – Berlin, 14.06.1995. p. 39–40.